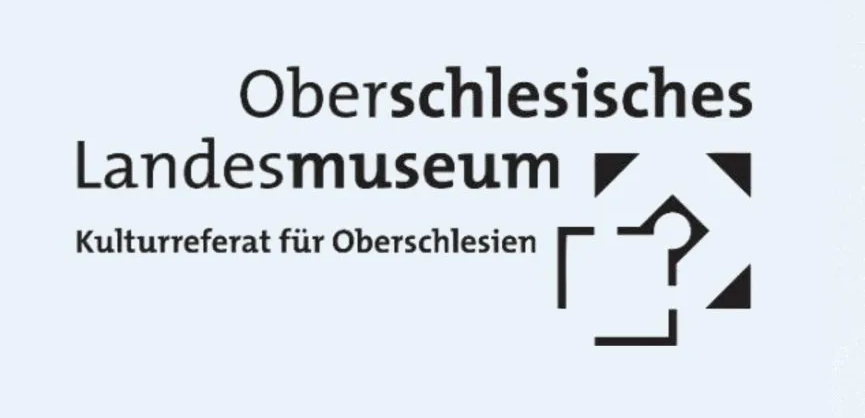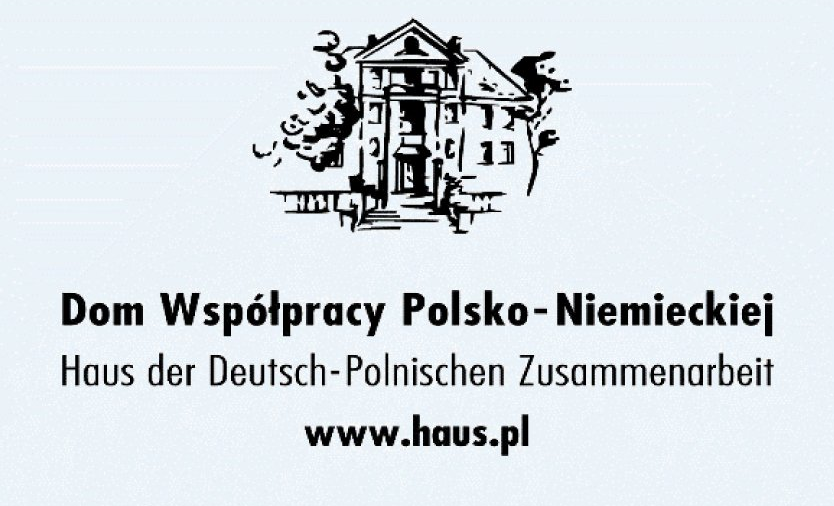Oppeln
(Opole)

Geschichte
Seit 1202 gehörte Oppeln zum schlesischen Teilherzogtum Oppeln-Ratibor. Im Jahre 1217 werden hier erstmalig „hospites“, d.h. Gäste, vermutlich erste deutsche Siedler, urkundlich genannt, denen Herzog Kasimir (1211 – 1229) die Schenken des Marktes und verschiedene Freiheitsrechte verlieh. Stadtpfarre wurde die 1223 erstmals belegte Kreuzkirche, die bereits vor 1239 zu einem Kollegiatstift ausgebaut wurde. Nach den Verwüstungen des Mongolensturmes 1241 wurde die Stadt erneut im Schachbrettmuster nach deutschem Recht mit dem Ring in der Mitte gegründet. Zu dieser Zeit entstand auch die Franziskanerkirche zur Heiligen Dreifaltigkeit. Die alte Pfarrkirche St. Adalbert wurde 1295 den Dominikanern übergeben. Bis 1532 war die Stadt Residenz der Oppelner Piasten, die jedoch über ein wechselnd großes Herzogtum geboten. Zu dieser Zeit war die Stadt gemischtsprachig, polnisch-deutsch.

Sehenswürdigkeiten

Häuser am Ring.

Blick auf das Rathaus.

Ansicht von der Oder aus.



Wehrgang der alten Stadtmauer...

... und Teilstück bei der Pfarrkirche an der Oder.
(ehem. Dominikanerkirche St. Adalbert und St. Maria)
Die Kirche wurde nach 1304 neu errichtet, später umgebaut und 1530 von den Dominikanern im Verlauf der Reformation verlassen. Von 1557 bis zur Rückkehr der Mönche 1604 wurde sie als evangelische Kirche genutzt. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurde die Kirche barockisiert sowie im 19. und 20. Jahrhundert mehrfach renoviert. Der Hauptaltar der Hl. Adalbert und Katharina ist spätbarock (um 1750). Im Norden zwischen Langhaus und Chor befindet sich eine Kapelle der Muttergottes von Tschenstochau mit einem Marienbild aus dem 17. Jahrhundert.

Ansicht von der Universitätsseite...

... und vom Ring aus.



Turm des herzoglichen Oberschlosses

Turm des Oberschlosses.

Der hl. Christoforus.

Franziskanerkirche vom Mühlgraben aus.

Altar und Grabplatten in der Annenkapelle.
(mit Alter Synagoge und Groschenbrücke)
Als „Oppelner Venedig“ werden die Gebäude im Westen der Altstadt, welche an den Mühlgraben grenzen, bezeichnet. Dazu gehört z.B. die Alte Synagoge in der Hospitalstrasse (ul. Szpitalna). Der Rechteckbau aus dem Jahre 1840 wurde 1897 nach dem Bau der neuen Synagoge an die verlagsfirma Erdmann Raabe verkauft. Derzeit wird das Gebäude als Buchhandlung genutzt. Die Hauptfassade zeigt zur Mühlgrabenseite.
Im Süden kreuzt die „Groschenbrücke“ (auch „Pfennigbrücke“ oder „Grüne Brücke“) den Mühlgraben. Sie stammt aus dem Jahre 1903 und hat ihren Namen daher, weil hier früher ein Zoll erhoben wurde.

Groschenbrücke.

Mühlgraben am Abend (Alte Synagoge rechts).
Gegenüber des "Oppelner Venedigs" liegt die Insel Pascheke mit den Resten des Oppelner Piastenschlosses. Dieses geht auf die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts zurück, wurde aber ab 1283 unter der Herrschaft von Herzog Boleslaus I. neu errichtet. Der bis heute erhaltene Turm stammt aus der Zeit um 1300.

Der Turm des alten Oppelner Schlosses.
Modernes Oppeln
Oppelner Nike (Siegesgöttin)
Das Denkmal wurde 1970 im Stil des sozialistischen Realismus zu Ehren der polnisch gesinnten Oberschlesier errichtet, die nach der für Deutschland erfolgreichen Volksabstimmung 1921 am Annaberg für einen Anschluss Oberschlesiens an Polen gekämpft hatten.

Neuer Text
Denkmal für Karol Musioł
Karol Musioł (1905 – 1983) war von 1952 bis 1965 Vorsitzender des Städtischen Nationalrates. Er war für den Wiederaufbau der Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg verantwortlich.

Museen
(Muzeum Śląska Opolskiego)
Das ehemalige Jesuitenkollegium neben der Adalbert-Kirche besteht aus zwei ehemaligen Bürgerhäusern aus dem Ende des 16. Jahrhunderts. Die Gebäude wurden in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts einheitlich barock umgestaltet. Seit 1932 wurde das Gebäude als Museum genutzt.
Das Museum des Oppelner Schlesiens, zu dem auch ein klassizistisches Nebengebäude gehört, enthält v.a. eine Sammlung archäologischer Funde aus der Oppelner Region, eine Ausstellung zur Geschichte der Stadt sowie zur Volkskunde der Region und eine Gemäldegalerie (Malerei des 19. Und 20. Jahrhunderts).
Öffnungszeiten
Montag Geschlossen
Dienstag 09:00–16:00
Mittwoch 09:00–16:00
Donnerstag 09:00–16:00
Freitag 09:00–16:00
Samstag 11:00–17:00


Informationen zum Alltagsleben im Mittelalter...

und Relikte aus der Neuzeit.

Exponate zur Holzbauweise im Oppelner Land.

(28. März 1840 in Oppeln - 23. Oktober 1892 in Kinena)
(Muzeum Wsi Opolskiej)
Im Oppelner Außenbezirk Birkowitz besteht seit 1970 ein Freilichtmuseum mit Denkmälern bäuerlicher Holzbauten aus der Oppelner Region, zumeist aus dem 18. Und 19. Jahrhundert. Insgesamt sind hier knapp 50 Wohn- und Wirtschaftsgebäude nach dem Vorbild eines Dorfes angeordnet. Dazu gehört eine Kirche (St. Katharina aus Grambschütz), eine Wassermühle (aus Alt-Schalkendorf), ein Kretscham sowie mehrere Windmühlen, Bauernhäuser, Ställe und Scheunen.
Viele der Häuser haben eine originale Innenausstattung und können besichtigt werden. Das Areal lädt den Besucher zum Bummeln ein und ermöglicht einen hervorragenden Einblick in die ländliche Wohn- und Arbeitsweise früherer Jahrhunderte.
Öffnungszeiten
April – Oktober Mo von 10:00-15:00 Uhr
Di-Fr von 10:00-17:00 Uhr
Sa-So von 10:00-18:00 Uhr


Übersichtsplan des Museumsgeländes.

Die Wassermühle im Museum.
Anreise
Weblinks
Serviceliste
-
800 Jahre Oppeln: 1217 - 2017 - Eine schöne StadtListenelement 1
Modern animierte Darstellung der Geschichte und Gegenwart von Oppeln (Opole) in deutscher und polnischer Sprache, fokussiert auch auf das Festival des polnischen Liedes
-
Opole - Das beliebte Reiseziel in PolenListenelement 2
Private Website mit zahlreichen Informationen über Oppeln (Opole), u.a. Übernachtungstipps und praktische Hinweise
-
Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen EuropaListenelement 3
Ausführliche – wissenschaftlich fundierte – Beschreibung der Geschichte der Stadt Oppeln in deutscher Sprache.